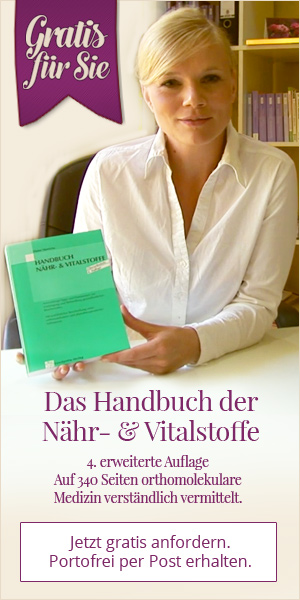Autor: Dr. Michaela Döll
Kaum ist die schöne Jahreszeit mit warmen Tagen, da schon haben wir wieder mit dem „Gemeinen Holzbock“ , der zur Gruppe der Schildzecken gehört, zu kämpfen. Warm und feucht mögen es die Schildzecken, zu denen desweiteren die Schaf‑, die Hunde‑, die Igel-und die Auwaldzecke gehören. Während der kalten Jahreszeit sind die Zecken in den oberen Bodenschichten inaktiv. Steigt die Temperatur aber auf etwa 1o Grad an, dann machen sich die Parasiten auf den Weg und suchen einen Wirt. So dienen beispielsweise Nagetiere, Reh- und Rotwild als Zwischenwirte und ermöglichen dem Spinnentier die Entwicklung von der Larve zum erwachsenen Tier. Der Mensch wird am meisten vom Holzbock (Ixodex ricinus) gestochen. Dieser ist inzwischen nicht mehr nur in der freien Natur anzutreffen, sondern erobert nach und nach auch die Großstädte. Amseln, Eichhörnchen, Igel und Füchse bringen die Blutsauger mit in die Stadt. Warme Winter und feuchte Sommer erhöhen die Populationsdichte der Zecken und lassen das Risiko für die durch diese Tiere übertragenen Krankheiten rasant ansteigen.
Blutsauger mit Widerhaken
Im Vergleich zu Insekten wie z. B. den Stechmücken, benötigen die Zecken extrem viel Blut. Um diese Zapfstellen zu sichern, besitzt das Tier ein ausgeklügeltes Saugsystem, welches mit allen Raffinessen ausgestattet ist. Zuerst sucht sich der blutsaugende Parasit Stellen am Körper aus, die z. B. mit Haaren bedeckt sind, wie etwa die Achselhöhle oder den Genitalbereich um einen guten Halt zu haben. Häufig sind auch die freien, unbedeckten Extremitäten betroffen. Beim Stechen sondert die Zecke ein Betäubungsmittel ab, so dass der Mensch den Einstich kaum spürt. Nun kann sie ihren Stechrüssel mit den zahlreichen kleinen Wiederhaken in den Wirt rammen und sich fest saugen. Dabei produzieren manche Arten auch noch eine Art Klebstoff, der das Festhalten an Mensch und Tier zusätzlich unterstützt. Auf diese Weise kann die Zecke viele Tage an ihrem „Spender“ hängen und fällt – wenn sie nicht bemerkt wird – erst ab, wenn der Saugvorgang beendet ist. Das aufgesaugte Blut schafft das Spinnentier in seinen Darm und wird dadurch groß und schwer. Eine vollgesaugte Zecke kann 200x so viel wiegen wie eine hungrige Artgenossin. Von einer einzigen großen Blutmahlzeit kann das Tier u. U. für Jahre zehren.
Zecken bringen Krankheiten
Während des Saugvorgangs der Zecken können Krankheitserreger übertragen werden. Zum einen handelt es sich um die FSME-Viren (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis), die eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Gehirnentzündung (Enzephalitis) zur Folge haben können. Jährlich erkranken etwa 200 Menschen an FSME. Zum anderen kann der Mensch durch Zecken mit dem Erreger der Borreliose, der nach seinem Entdecker Herrn Dr. Willi Burgdorfer als Borrelia burgdorferi benannt wurde, infiziert werden. Diese Bakterien bringen jährlich etwa 100 000 Menschen die sogenannte Lyme-Borreliose. Den Namen erhielt die Erkrankung von der Stadt Lyme in den USA, wo man bei Jugendlichen in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstmalig das Krankheitsbild beobachtete. Die Betroffenen litten vor allem unter Gelenkbeschwerden und da diese Fälle saisonal gehäuft (Sommer, Frühherbst) auftraten, vermutete man bereits damals schon eine Infektion als Ursache. Die Lyme-Borreliose ist, laut Statistik des Robert-Koch-Instituts, die häufigste durch Zecken übertragene Infektionskrankheit in Europa. Am häufigsten sind Kinder (Alter 5 – 9 Jahre) und ältere Erwachsene (60 – 69 Jahre) betroffen.
So kann sich eine Borreliose zeigen:
| Stadium I | Stadium II | Stadium III |
| Wanderröte Abgeschlagenheit Fieber Kopf- , Glieder‑, Muskelschmerzen Lymphknotenschwellungen |
Nervenschmerzen und ‑entzündungen Muskel‑, Gelenkschmerzen Lähmungserscheinungen Herzprobleme Psychische Probleme Angstzustände |
Erschöpfung Ausfallerscheinungen Gehirnentzündung Hautveränderungen Gelenkentzündungen Schmerzen und Leidensdruck Erwerbsunfähigkeit |
Borreliose – eine „Multi-System-Erkrankung“
Nachdem die Zecke abgefallen bzw. entfernt worden ist empfiehlt es sich, die Einstichstelle für die nächsten Tage/Wochen zu beobachten. Bei der Borreliose tritt häufig (aber bei Weitem nicht immer!) die sogenannte Wanderröte (Erythema migrans) auf. Dabei handelt es sich um eine scharf abgegrenzte Rötung um die Einstichstelle herum, die im Zentrum oft eine Aufhellung aufweist. Etwa 40 – 60 % der Betroffenen zeigen eine solche Wanderröte. Daneben können sich auch unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellungen und Abgeschlagenheit einstellen. Im zweiten Stadium der Erkrankung, welches mit Wochen bis Monaten nach dem Zeckenbefall angegeben wird, können Nervenschmerzen auftreten, die sich nachts verschlimmern können. Auch Lähmungserscheinungen (z. B. Gesichtsnerv) kommen vor. Orthopädische Probleme können sich einstellen und schließlich kann auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen werden.
Im dritten Stadium der Erkrankung (chronisches Stadium) können sich Monate bis Jahre nach dem Zeckenkontakt Folgeschäden zeigen, die z. B. das Nervensystem oder die Haut betreffen. Ausfälle im Bereich des Zentralnervensystems sind typisch für die Neuroborreliose, die bei 10 % der Betroffenen vorkommt. Die Akrodermatitis chronica atrophicans ist charakterisiert durch „zigarettenpapierartige“ Verdünnung der Haut an Händen und Füßen, die häufig mit einer deutlichen Venenzeichnung (Blaufärbung) einher geht. Frauen sind von diesen Hautveränderungen häufiger betroffen als Männer. Gelenkentzündungen („Lyme- Arthritis“), die sich vorwiegend auf die Knie- und Sprunggelenke beziehen, können ebenfalls beobachtet werden. Die einzelnen Stadien sind teilweise schwer voneinander abzugrenzen, fließende Übergänge sind möglich.
Antibiotika – hier sind probiotische Bakterien sinnvoll
Da es gegen die Borreliose bislang keine Impfung gibt, sind vorbeugende Maßnahmen nur in eingeschränktem Maß möglich. Bei frühzeitiger Diagnose ist die Anwendung von Antibiotika angezeigt und meist auch erfolgreich. Auch im fortgeschrittenen Stadium werden antibiotisch wirksame Medikamente eingesetzt – deren Effizienz ist aber häufig wesentlich geringer als bei einem rechtzeitigen Einsatz.
Antibiotika wirken nicht nur gegen den Borrelioseerreger, sondern fegen gleichzeitig die „guten“ Bakterien im Darm weg. Das ist für das Immunsystem von Nachteil, da die Darmflora maßgeblich an der körpereigenen Abwehr beteiligt ist. Im Darm sind 80 % des Immunsystems (genauer des lymphatischen Apparates) angesiedelt. Daher ist es hilfreich, den dezimierten Darmbakterien nach erfolgter Antibiotikumtherapie wieder „an den Start“ zu helfen. Probiotika (griech.: „pro bios“ = für das Leben) sind „gute“ Bakterien, die das Gleichgewicht im Darm wieder herstellen und dem Immunsystem wieder „auf die Sprünge helfen“ können. Es kann sogar sinnvoll sein, die probiotischen Bakterien bereits während der Antibiotikumanwendung zu zuführen, um der antibiotikumassoziierten Diarrhoe entgegen zu wirken, die etwa 20 % aller Betroffenen während der Behandlung entwickeln.
Jetzt sind Powerstoffe als Unterstützung für den Körper gefragt
Vitamine und Elektrolyte sind für den Körper im Krankheitsfall besonders wichtig, da viele Stoffwechselleistungen (z. B. Entgiftung, enzymatische und hormonelle Reaktionen) und Abwehrmechanismen diese Mikronährstoffe als Cofaktoren benötigen. Unser Immunsystem besteht aus über tausend Milliarden Zellen, von denen täglich etwa zehn Prozent erneuert werden müssen. Dafür benötigt der Körper jede Menge Vitalstoffe. Wichtige Schutzfaktoren sind auch die Antioxidantien (Radikalfänger) wie z. B. die Vitamine C (z. B. in Camu-Camu-Extrakt in hoher Konzentration vorhanden) und E oder das Spurenelement Selen. Diese Radikalfänger unterstützen den Körper bei der körpereigenen Immunabwehr und im Kampf um schädliche freie Radikale, die u. a. auch durch die Anwendung von Medikamenten (z. B. Antibiotika) im Körper vermehrt entstehen. Auch das Spurenelement Zink ist hier von Bedeutung, da es in nahezu alle Abwehrleistungen des Körpers eingreift. Ohne Zink ist das Immunsystem nicht leistungsfähig und Abwehrschwächen sind nicht selten auch mit einem Zinkmangel verknüpft. Leider kommt das Spurenelement vorwiegend in tierischen Produkten vor, so dass vor allem Vegetarier häufig mit diesem Immunpowerstoff unterversorgt sind. Bioaktive Pflanzenstoffe wie z. B. die Polyphenole aus Granatapfel, Grüntee, Zistrose und Beerenfrüchten stärken die Abwehrkraft zusätzlich und wirken entzündlichen Prozessen im Körper entgegen.
Mit den genannten Stoffen kann man die körpereigene Abwehr „fit machen“ und die Immunreaktionen im Kampf um die Borreliose effizient unterstützen.
B‑Vitamine – bei neurologischen Begleiterscheinungen besonders wichtig
Für die Funktionsfähigkeit der Nerven ist die ausreichende Versorgung mit B- Vitaminen unabdingbar. Klinische Studien haben gezeigt, dass die ausreichende Zufuhr an B‑Vitaminen bei Infektionen mit Borrelien einen hohen Stellenwert einnimmt, um den neurologischen Begleitsymptomen entgegen zu wirken. Ein Mangel an Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Folsäure oder Vitamin B12 kann Symptome wie z. B. Müdigkeit, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, Kribbeln, Taubheitsgefühl in Armen und Beinen, die bei der Borreliose häufig auftreten, mitbegünstigen. Auch die Blutneubildung kann unter einer unzureichenden Zufuhr an diesen Mikronährstoffen (vor allem Folsäure und Vitamin B12) eingeschränkt sein.
Zudem kann die Anwendung von Antibiotika zu einem Defizit beitragen, da eine Reihe dieser medikamentösen Wirkstoffe die Aufnahme der B‑Vitamine über die Darmschleimhaut in das Blut hemmen. Übrigens werden die B‑Vitamine auch beim Erhitzen der Lebensmittel um bis zu 80% zerstört.
Hilfe bei entzündeten Gelenken und Muskelschmerzen
Die „richtigen“ Fette (Fettsäuren) können dabei helfen, Entzündungen im Körper, z. B. bei Borreliose in den Gelenken, zu bekämpfen. Zu diesen antientzündlich wirksamen Fettsäuren gehören die Omega-3-Fettsäuren, die im Kaltwasserfisch (z. B. Hering, Lachs, Thunfisch, Makrele) vorkommen. Wer nicht unbedingt mehrere Fischmahlzeiten pro Woche verzehren möchte kann auch auf Fischölkapseln mit den wertvollen langkettigen Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) zurück greifen. Auch Pflanzenextrakte wie z. B. der Indische Weihrauch (Boswellia serrata), wirken entzündungshemmend.
Unterstützend können bei Gelenkbeschwerden auch Knorpelstoffe (Glucosamin- und Chondroitinverbindungen) zum Einsatz kommen. Diese Substanzen kommen natürlicherweise im Gelenkknorpel vor und sind für die Elastizität und die Druckfestigkeit des Knorpels von erheblicher Bedeutung. Kommt es im Gelenk zu Abnutzungserscheinungen, dann geht die wertvolle Knorpelschicht mehr und mehr verloren. Das betroffene Gelenk schmerzt und führt zu Bewegungseinschränkungen. Die genannten Knorpelstoffe unterstützen den Knorpel und wirken schmerzreduzierend.
Bei Muskelkrämpfen und Muskelschmerzen, die im Zuge der Borreliose auch auftreten können, ist Magnesium ein wertvoller Mineralstoff. Magnesium ist an mehr als 300 enzymatischen Reaktionen in unserem Körper beteiligt. Für die Muskelkontraktion ist das Allroundtalent besonders wichtig. Waden- und Muskelkrämpfe werden durch eine unzureichende Zufuhr begünstigt. Aber auch Lähmungserscheinungen, Unruhezustände, Nervosität und Herzschwäche können die Folgen eines Magnesiummangels sein.
Resumee
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Mikronährstoffe bei der Borreliose ein sinnvolles Adjuvans darstellen, welches den Körper bei der Bekämpfung der Infektion in vielerlei Hinsicht effizient unterstützen kann. Eine Supplementierung erscheint daher sinnvoll, da der Bedarf an Vitalstoffen im Zuge der Erkrankung – auch Antibiotika-bedingt – erhöht ist und diesem über eine vitalstoffreiche Kost alleine in vielen Fällen sicherlich nur bedingt begegnet werden kann.